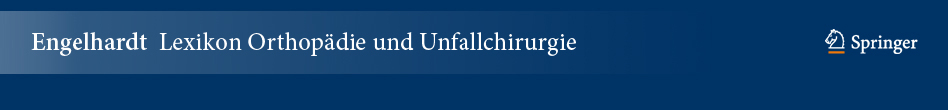
Knochentransplantation
Synonyme
Knochenimplantation; Knochenspan; Knochentransplantation, autologe; Knochentransplantation, homologe; Knochentransplantation, allogene; Kortikospongiöser Span
Englischer Begriff
Bone transplantation
Definition
Bei ca. 15 % aller Operationen am Skelettsystem ist ein Knochenersatz notwendig. Dabei kommen verschiedene Transplantate und Knochenersatzmaterialien zum Einsatz:
- autogenes Transplantat: körpereigenes Gewebe, das einer Donorstelle entnommen und in der Bedarfsregion eingebracht wird (in Einzelfällen, z. B. bei Rekonstruktion eines Pfannendefekts bei Protrusionskoxarthrose, können Donorstelle und Bedarfsregion übereinstimmen),
- allogenes Transplantat: Transplantat aus der Knochenbank von einem anderen Menschen,
- alloplastisches Transplantat: synthetisch hergestelltes Transplantat, die dem körpereigenen Gewebe ähnlich ist.
Indikation
Knochentransplantate finden bei angeborenen oder erworbenen Substanzdefekten Verwendung:
- zu rekonstruktiven Eingriffen am Bewegungsapparat,
- zur Behandlung von Frakturen,
- in der Endoprothetik, insbesondere bei Prothesenwechseloperationen,
- zur Defektauffüllung bei ausgedehnten Knochentumoren und Zysten,
- bei Pseudarthrosen sowie nach Osteotitis und Osteomyelitis,
- bei traumatischen Schädeldefekten,
- zur Arthrodese und zur Spondylodese.
Kontraindikation
Fehlende Operationsfahigkeit. Weiterhin ist eine Knochentransplantation beim Vorliegen einer Infektion kontraindiziert. Außerdem ist vorab eine Beurteilung des Ersatzlagers vorzunehmen und gegebenenfalls zur Verbesserung der Einheilungsbedingungen zunächst vorbereitende chirurgische Maßnahmen wie Weichteil- und Knochendébridement, Weichteilrekonstruktionen und Osteosynthesen erforderlich.
Durchführung
Autogene Spongiosatransplantate sind hinsichtlich ihrer biologischen Wertigkeit den anderen Knochentransplantaten überlegen und stellen besonders bei kleinen Defekten den Goldstandard dar. Da körpereigenes Gewebe transplantiert wird, kommt es zu keinen Abstoßungsreaktionen. Die ergiebigsten Stellen für die Entnahme sind die dorsalen und ventralen Beckenkämme. Weitere Donorstellen sind der Tibiakopf, die Fibula, die Rippen, distaler Radius und Trochanter major. Größere Defekte lassen sich mit vaskulär gestielten oder mikrochirurgisch an das Gefäßnetz im Empfangsgebiet angeschlossenen Transplantaten erzielen, die auch günstigere Einheilungsergebnisse aufweisen.
Eingeschränkt werden die Anwendungsmöglichkeiten des autogenen Knochenersatzes durch die limitierte Verfügbarkeit sowie der Zumutbarkeit einer zusätzlichen Operation an einer geeigneten Donorstelle. Darüber hinaus geht die Transplantatentnahme mit einer nicht zu vernachlässigenden Komplikationsrate (Hämatombildung, Nervenläsionen, erhöhtes Infektionsrisiko, Frakturrisiko) einher.
Allogene Transplantate werden insbesondere zur Deckung größerer Defekte verwendet oder wenn ein zur Gewinnung autogenen Materials nicht vertretbarer Zweiteingriff notwendig wird, z. B. bei Kindern, Schwerverletzten oder Patienten in schlechtem Allgemeinzustand. Das Material stammt beispielsweise aus resezierten Hüftköpfen bei Totalendoprothesen sowie von Organspendern. Beim allogenen Transplantat tritt das Problem der Fremdkörperreaktionen auf, da allogene Transplantate durch die übertragenen Zellkomponenten immunologische Reaktionen verursachen können. Auch die Möglichkeit der potentiellen Übertragung infektiöser Krankheiten stellt ein Problem dar. Immerhin beträgt das Risiko einer bei Transplantation aufgetretenen HIV-Infektion 1 : 1 Million. Dies alles macht die Beachtung von Richtlinien für die Spenderauswahl und die Organisation einer Knochenbank, womit ein erheblicher Aufwand sowie Mehrkosten verbunden sind, notwendig. Allogene Transplantate erfüllen auch nach der in der Regel durchgeführten Thermobehandlung die biomechanischen Anforderungen an einen Knochenersatzstoff. Der Festigkeitsverlust des Knochens ist gering.
Alloplastische Materialien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die unbegrenzte Verfügbarkeit, das Vermeiden eines wie beim autogenen Transplantat notwendigen Zweiteingriffs sowie fehlende Abstoßungsreaktionen geben ihnen ihren Stellenwert. Die Kombination mit autogenen Materialien ermöglicht Teilosteogenität. Inkomplettes Einwachsen mit Integration lediglich am Implantatrand, Verwendung nur kleiner Volumina, Sprödigkeit des Materials aufgrund der kristallinen Struktur sowie eine mögliche Veränderung der Spannungsverhältnisse im umgebenden Knochen durch die hohe Steifigkeit der Implantate, gelten als Nachteile des Verfahrens.
Nachbehandlung
Grundlage für das ungestörte Einheilen des Transplantats ist neben ausreichender Durchblutung des Transplantats vor allem die mechanische Geweberuhe im Transplantatbett.
Daher sollte das Osteosynthesematerial bis zum funktionellen Einbau des Knochentransplantats verbleiben, wobei die Einheilungszeit vom transplantierten Volumen abhängt.
Autor
Matthias Bühler, Hergo Schmidt
© Springer 2017 |
Powered by kb-soft |
|



