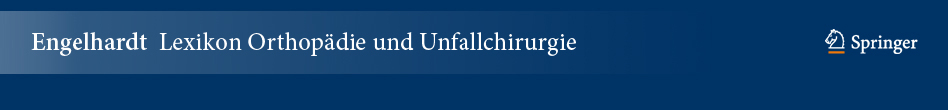
Spondylarthrose
Synonyme
Pseudoradikulärsyndrom; Wirbelgelenkarthrose; Facettenarthrose; Facettensyndrom
Englischer Begriff
Spondylarthrosis; Facet syndrome
Definition
Lokale lumbale oder pseudoradikuläre Schmerzen, die durch eine Erkrankung der Wirbelgelenke eines oder mehrerer Bewegungssegmente ausgelöst werden.
Pathogenese
Die Wirbelgelenke können bei einer Bandscheibenerniedrigung oder Haltungsstörung (Hyperlordose der Lendenwirbelsäule) vermehrt mechanisch belastet werden. Verstärkte Druck-und Scherbelastung führen oft zu uncharakteristischen Beschwerden (Facettensyndrom). Kommt es zu einer Erniedrigung der Bandscheibe (z. B. bei einem Prolaps oder nach operativer Nukleotomie), kann sich durch die vermehrte mechanische Belastung der Wirbelgelenke eine Spondylarthrose entwickeln. Dabei ist eine Knochenapposition im Bereich der Wirbelgelenke möglich, so dass es zu einer Facettenhypertrophie mit Einengung des Wirbelkanals und der lateralen Recessus (Lumbalstenose) kommen kann. Dies kann wiederum Ursache für eine Nervenwurzelirritation sein.
Symptome
Die Patienten beklagen beim Befall der Lendenwirbelsäule tiefsitzende Kreuzschmerzen, die vor allem nach längerem Stehen oder Gehen auftreten. Eine Ausstrahlung bis in das Gesäß oder die hinteren Oberschenkel ist möglich (Pseudoradikulärsyndrom). Sind die Wirbelgelenke in Höhe der Brustwirbelsäule betroffen, können die Schmerzen entlang des knöchernen Thorax nach vorn ausstrahlen und auch zu einem atemabhängigen Schmerz führen. Vergleichsweise selten ist das Facettensyndrom im Bereich der Halswirbelsäule ausgeprägt. Hier stehen lokale Beschwerden mit Bewegungseinschränkung und Ausstrahlung in die Schultern im Vordergrund.
Diagnostik
Die Beweglichkeit im betroffenen Wirbelsäulenabschnitt ist oft eingeschränkt. Eine Steigerung des Tonus der paravertebralen Muskulatur ist häufig. Durch Erschütterung der Wirbelsäule können die Beschwerden oft ausgelöst werden. Dies kann durch Beklopfen der Wirbelsäule oder den Rütteltest überprüft werden. Dabei „rüttelt“ der Untersucher am Bein des liegenden Patienten, was zu einer Erschütterung der Lendenwirbelsäule führt. Auch das Viererzeichen (Außenrotation und Abduktion im Hüftgelenk, wobei der Unterschenkel auf dem gegenseitigen Oberschenkel abgelegt wird) kann zu einer Schmerzprovokation führen. Mit einer gezielten Infiltration der betroffenen Wirbelgelenke kann, wenn ein Facettensyndrom vorliegt, eine vorübergehende Schmerzlinderung oder Schmerzfreiheit erreicht werden. Es ist empfehlenswert, diese Infiltrationen unter Durchleuchtungskontrolle durchzuführen, um die diagnostische Aussagekraft zu erhärten.
Die bildgebende Diagnostik umfasst die Röntgenaufnahmen des Wirbelsäulenabschnitts in zwei Ebenen und einer schrägen Projektion. Kernspintomographie und Computertomographie sind ebenfalls geeignet, die Erkrankungen der Wirbelgelenke weiter abzuklären.
Differenzialdiagnose
Bandscheibenprolaps, Nervenwurzelreizsyndrom, entzündliche Erkrankungen (Spondylitis, Spondylodiszitis), Spondylolisthesis, Spinalkanalstenose, Erkrankung des Kreuz-Darmbein-Gelenks, tumoröse Erkrankungen, Organerkrankungen (z. B. Herzinfarkt, Nierenerkrankung, Darmerkrankung, gynäkologische Erkrankung).
Therapie
Die Behandlung eines Facettensyndroms ist eine Domäne der konservativen Behandlung. Wenn den Beschwerden eine fortgeschrittene Arthrose der Wirbelgelenke zugrunde liegt, können operative Maßnahmen indiziert sein.
Akuttherapie
Medikamentöse Schmerzlinderung; Immobilisation, entlastende Lagerung (Entlordosierung bei Befall der Lendenwirbelsäule).
Konservative/symptomatische Therapie
Nach Abklingen des akuten Krankheitsbilds steht die muskuläre Stabilisation des Wirbelsäulenabschnitts im Vordergrund. Bei Befall der Lendenwirbelsäule kann die Entlordosierung durch Übungen zur Beckenkippung ergänzt werden. Entlordosierende Orthesen können vorübergehend eingesetzt werden. Die physikalischen Maßnahmen umfassen Wärme- und Stromanwendungen (TENS, Interferenz, Hochvolt).
Die Behandlung mit Infiltrationen, Kryosonden, Thermokoagulation bzw. Radiofrequenztherapie und YAG-Laser haben zum Ziel, die nozizeptiven Rezeptoren der betreffenden Wirbelgelenke zu „denervieren“, um eine vorübergehende Schmerzfreiheit (sechs bis acht Monate) zu erzielen.
Medikamentöse Therapie
Nicht-steroidale Antiphlogistika, Muskelrelaxantien.
Operative Therapie
Liegt dem Facettensyndrom eine konservativ nicht beherrschbare Symptomatik auf dem Boden einer Arthrose der Wirbelgelenke zugrunde, so kann eine Versteifung dieses Bewegungssegments durchgeführt werden. Das Ziel ist dabei die knöcherne Überbauung der betreffenden Wirbelgelenke. Die Stabilisation erfolgt über eine transpedikuläre Instrumentierung. Selten kommt es nach Nukleotomie durch die reduzierte Höhe des Bandscheibenraums zur postoperativen Entwicklung eines Facettensyndroms. Hier kann die Wiederherstellung der Höhe des Zwischenwirbelraums und damit die Entlastung der Wirbelgelenke mit einer Bandscheibenprothese sinnvoll sein.
Dauertherapie
Ein kontinuierliches isometrisches Training der Rumpfmuskulatur und das Ausüben bestimmter Sportarten (Rückenschwimmen, Nordic Walking, Fahrradfahren) sind geeignet, Erkrankungen der Wirbelgelenke vorzubeugen. Die Einweisung in rückenschonendes Verhalten ist unverzichtbar.
Bewertung
Das Facettensyndrom ist eine chronische Erkrankung der Wirbelsäule, die häufig zu rezidivierenden Schmerzexazerbationen führen kann. Allerdings ist die konservative Therapie in den meisten Fällen erfolgversprechend.
Nachsorge
Die fachärztliche Behandlung ist bis zum Eintritt der Beschwerdefreiheit indiziert. Bei chronisch-rezidivierenden Facettensyndromen ist eine weiterführende Diagnostik zum Ausschluss möglicher Differentialdiagnosen angezeigt.
Autor
Renée Fuhrmann
© Springer 2017 |
Powered by kb-soft |
|











